Sonntag, 8. Mai 2016
Veränderliche Konstanten
Am 8. Mai 2016 im Topic 'Tiefseetauchen'
So lange es nichts gab, das mich zufällig in die Nähe meines Heimatortes verschlagen hatte, habe ich auch nicht groß darüber nachgedacht, ob und wie sich dieses Dorf verändert haben könnte. Man sagt ja gerne, dass man seine Heimat zwischenzeitlich einmal (auch für länger) verlassen haben muss, um wieder neu dorthin zurückkehren zu können. Aber dass ich hinfuhr, war kein bewusster Vorsatz, sondern lag an einer Baustelle, die ich umfahren musste, als ich den Gatten am Freitag zum Bahnhof brachte. Bewusst, wenn auch notgedrungen zurückgekehrt war ich in das Nest bereits vor Jahren. Ich weine ihm keine Träne nach.
Natürlich hat das Dorf auch seine schönen Ecken. Da ist die kleine, gotische Kirche, die von alten Bäumen umgeben am Hang eines kleinen Höhenrückens liegt. Es gibt ein paar ganz hübsche Kopfsteinpflastergassen und einen Park an der anderen Seite des Hangs, von dem aus man weit über die Landschaft sehen kann. Dennoch möchte ich dort - wie man in unserer Ecke so schön sagt - nicht tot überm Zaun hängen. Es ist ja nicht so, dass ich ein Faible für Metropolen habe. Aber dieses Dorf ist inzwischen ein klassisches Wohndorf, eine Art altbackenes Suburbia, aus dem die spannenden Orte meiner Kindheit längst verschwunden sind. Der Trampelpfad entlang der Eisenbahngleise, den wir zur Schule gingen, existiert nicht mehr. Den alten Sandsteinbruch haben sie sozusagen domestiziert und ein Museum draus gemacht. Ich mochte ihn lieber mit den Brombeerranken und dem leisen Kribbeln, das entstand, wenn wir uns über das Zutrittsverbot hinwegsetzten. Vielleicht romantisiere ich ja auch.
Auf dem Rückweg vom Bahnhof nach hause entschließe ich mich, einen Blick auf das Dorf zu werfen, auch wenn ich ziemlich genau weiß, dass das nichts mehr mit meinen Erinnerungen und Erlebnissen zu tun hat. Ich wollte wissen, was ich noch erkennen würde. Was würde sich erneut verändert haben?
Ich biege also hinterm Ortseingang nach links ein, stelle das Auto auf dem Parkplatz ab und gehe zuerst zum Grab meiner Großmutter auf den Friedhof. Es ist erst halb acht morgens, die Sonne hat bereits erstaunliche Kraft, der Himmel ist strahlend blau, und der Friedhof liegt vollkommen still da. Selbst, obwohl ich später selbst nicht beerdigt, sondern verbrannt werden möchte, üben Friedhöfe eine große Faszination auf mich aus. Inzwischen gibt es auch auf diesem Friedhof ein Urnenfeld - etwas, das sehr unüblich für diese Gegend ist. Ich versuche mich zu erinnern, wo genau das Grab meiner Großmutter ist. Ich bin nicht oft hingegangen. Mir kommen Erinnerungen an ihr Begräbnis. Wie die Nachbarn mit ihrem Sarg auf den Schultern beinahe stolperten und wie meine Schwester sich nach dem Beerdigungskaffee darüber echauffierte. Ich besitze noch das Foto, das sie damals von dem frisch aufgeschütteten Grabhügel machte, der unter Kränzen und Blumen verschwand.
Während ich noch suche, entdecke ich vertraute Namen. Unsere alten Nachbarn samt ihrem Sohn. Eltern einer Schulfreundin meiner Schwester. Immer der Gedanke: "Ach, die auch...". Ich war sehr lange nicht mehr da. Vom Tod mancher Menschen hatte ich gehört. Ich wusste auch, dass die Grabstätte meiner Großeltern nach dem Wiederkauf verändert worden war. Ich lasse den Blick an den Reihen entlang schweifen und suche den polierten, schwarzen Stein, und ich bin schon drauf und dran, zu gehen, als ich ihn schließlich finde. Koniferen bedecken halb die Namen, dazwischen eine Reihe Trittsteine, die sind wie immer. Ich bleibe stehen und sehe mir die Daten an. 1909 - 1965 und 1911 - 2003. Meine Großmutter hat länger ohne ihren Mann gelebt als mit ihm und starb zehn Tage nach der Hochzeit meiner Schwester. Die Sträucher, die trockene, graue Erde und die in den Stein geschnittenen Zeichen haben nichts mit dem Moment zu tun, als ich zum letzten Mal ihre Hand hielt, ihr durch das wirre, graue Haar strich (wir nannten sie mit dieser Frisur zum Schluss oft scherzhaft "Einstein"), wie ich ihr Herz auf dem Überwachungsmonitor schneller schlagen sah. Sie hat mich gehört und gespürt. Eine Viertelstunde später war sie tot. Das ist dreizehn Jahre her.
Irgendwann taucht ein Friedhofsgärtner auf, grüßt in der bei uns üblichen, wortkargen Art und geht weiter. Ich frage mich, ob ich wohl noch das Grab der Mutter meiner besten Grundschulfreundin finde. Ich frage mich, ob sie selbst wohl noch lebt. Wenn man den Kontakt zu seinen Eltern einstellt, dann funktioniert auch das Buschtelefon nicht mehr. Ich weiß nur, dass diese Freundin die Veranlagung ihrer Mutter zum Brustkrebs erbte.
Ich verlasse den Friedhof. Mir fällt jetzt erst auf, wie klein er ist. Alles ist klein. Das ganze Dorf scheint geschrumpft zu sein. Ich lenke das Auto an der Kirchmauer entlang, auf der wir als Jugendliche oft im Sommer mit baumelnden Beinen gesessen hatten. Der Schaukasten mit den Gemeindemitteilungen steht noch an derselben Stelle, der Rasen sauber gemäht, gebastelte Papierschmetterlinge im Fenster des Gemeindehauses. Die Kneipe am Brunnen hat jetzt einen anderen Namen (ich glaube, sie heißt pfiffigerweise jetzt "Gasthaus am Brunnen"). Das Möbelhaus in Achtzigerjahre-Architektur gegenüber steht immer noch leer. Ein glatzköpfiger Mann mit einem dicken Hund geht das Kopfsteinpflaster hinauf. Im Dönerladen meiner Jugend werden jetzt Blumen verkauft, in der Eisdiele von damals Pizza und Döner. Dinge ändern sich, obwohl sie sich nicht ändern.
Wenn du nicht da bist, während sich die Dinge ändern, dann kommt die Änderung so plötzlich. Ich frage mich, wie vielen alten Menschen es so gehen muss. Häuser werden abgerissen, hochgezogen, Straßen verlegt, und du selbst hast doch nur zehn Jahre nicht hingeschaut, und dann ist alles anders. Dort, wo ich jetzt zuhause bin, ändern sich alles sukzessive. Ich sehe es, kann es greifen, und mein Gedächtnis ist mir treu. Aber dieses Dorf ändert sich nicht nur äußerlich. Meine Distanz ist nicht nur räumlich. Hier und da ein Ankerpunkt, ja. Eine Erinnerung. Oder ein Grab. Verwandte. Eine Durchfahrt. Aber auch die Erinnerungen relativieren sich. All die Kurven, um die ich hunderttausend Mal gebogen bin, haben nur so geringe Bedeutung. Die Türen, vor denen ich gestanden und die Fenster, zu denen ich hinaufgeschaut habe, sind in meinen Tagebüchern lebendiger als in der Wirklichkeit. Die Schleichwege, die ich kannte, sind Kindheitserinnerungen. Es gibt sie nicht mehr.
Es ist auch die eigene Veränderung, oder vielleicht vor allem die, die mich von all dem noch weiter entfernt. Meine Schwester ist oft mit ihren Kindern bei den Großeltern, sie schafft neue, lebendige Verbindungen zu diesem Ort. Ich tue das nicht. Vielleicht gehe ich eines Tages mit meiner Cousine durch das Dorf, meiner Tante, meinem Mann. Vielleicht sogar mit meinem Vater, meiner Mutter. Ich weiß nicht, was noch kommen wird. Vielleicht komme ich auch weiterhin nur selten zurück, und die Wirklichkeit bleibt nurmehr eine Skizze meiner Erinnerung, die entfernte Ähnlichkeit hat. Das Leben ist, wo ich gerade bin.
Meine Oma sieht mich von dem Foto her an, das an der Wand meines Dachzimmers hängt. Sie hat ein Baby auf dem Schoß in einem gelb-roten Frottee-Strampelanzug, und sie hält seine kleine Hand zart zwischen ihren großen, groben Fingern. Mich. Sie hat mich immer gehalten. Die Erinnerung an sie steckt auch in diesem Dorf. Sie steckt in dem alten Haus mit der Schmiede, in dessen Garten ich als ganz kleines Kind auf dem Bauch in der Sonne lag und das schon lange nicht mehr steht. Sie steckt in dem Friseurladen, zu dem ich sie untergehakt begleitete und der schon längst geschlossen hat. Sie steckt in den Einkaufszetteln, die sie schrieb und auf denen jede Woche drei Dosen Kondensmilch standen, so als könne jederzeit eine Konsensmilchknappheit eintreten. In den Zetteln, die ich mitnahm, um für sie einzukaufen bei dem kleinen Spar-Markt, den es schon lange nicht mehr gibt. Sie steckt in der Gartenerde, in die sie säte und die sie mit ihren Holzschuhen sorgfältig festtrat.
Ich höre sie auf Plattdeutsch meinen Namen nennen. Höre sie liebevoll mit dem Hund schimpfen. Sie ist mit dem Ort fest verwoben und mit mir und der Ort mit mir.
Gehen wir weiter.
Natürlich hat das Dorf auch seine schönen Ecken. Da ist die kleine, gotische Kirche, die von alten Bäumen umgeben am Hang eines kleinen Höhenrückens liegt. Es gibt ein paar ganz hübsche Kopfsteinpflastergassen und einen Park an der anderen Seite des Hangs, von dem aus man weit über die Landschaft sehen kann. Dennoch möchte ich dort - wie man in unserer Ecke so schön sagt - nicht tot überm Zaun hängen. Es ist ja nicht so, dass ich ein Faible für Metropolen habe. Aber dieses Dorf ist inzwischen ein klassisches Wohndorf, eine Art altbackenes Suburbia, aus dem die spannenden Orte meiner Kindheit längst verschwunden sind. Der Trampelpfad entlang der Eisenbahngleise, den wir zur Schule gingen, existiert nicht mehr. Den alten Sandsteinbruch haben sie sozusagen domestiziert und ein Museum draus gemacht. Ich mochte ihn lieber mit den Brombeerranken und dem leisen Kribbeln, das entstand, wenn wir uns über das Zutrittsverbot hinwegsetzten. Vielleicht romantisiere ich ja auch.
Auf dem Rückweg vom Bahnhof nach hause entschließe ich mich, einen Blick auf das Dorf zu werfen, auch wenn ich ziemlich genau weiß, dass das nichts mehr mit meinen Erinnerungen und Erlebnissen zu tun hat. Ich wollte wissen, was ich noch erkennen würde. Was würde sich erneut verändert haben?
Ich biege also hinterm Ortseingang nach links ein, stelle das Auto auf dem Parkplatz ab und gehe zuerst zum Grab meiner Großmutter auf den Friedhof. Es ist erst halb acht morgens, die Sonne hat bereits erstaunliche Kraft, der Himmel ist strahlend blau, und der Friedhof liegt vollkommen still da. Selbst, obwohl ich später selbst nicht beerdigt, sondern verbrannt werden möchte, üben Friedhöfe eine große Faszination auf mich aus. Inzwischen gibt es auch auf diesem Friedhof ein Urnenfeld - etwas, das sehr unüblich für diese Gegend ist. Ich versuche mich zu erinnern, wo genau das Grab meiner Großmutter ist. Ich bin nicht oft hingegangen. Mir kommen Erinnerungen an ihr Begräbnis. Wie die Nachbarn mit ihrem Sarg auf den Schultern beinahe stolperten und wie meine Schwester sich nach dem Beerdigungskaffee darüber echauffierte. Ich besitze noch das Foto, das sie damals von dem frisch aufgeschütteten Grabhügel machte, der unter Kränzen und Blumen verschwand.
Während ich noch suche, entdecke ich vertraute Namen. Unsere alten Nachbarn samt ihrem Sohn. Eltern einer Schulfreundin meiner Schwester. Immer der Gedanke: "Ach, die auch...". Ich war sehr lange nicht mehr da. Vom Tod mancher Menschen hatte ich gehört. Ich wusste auch, dass die Grabstätte meiner Großeltern nach dem Wiederkauf verändert worden war. Ich lasse den Blick an den Reihen entlang schweifen und suche den polierten, schwarzen Stein, und ich bin schon drauf und dran, zu gehen, als ich ihn schließlich finde. Koniferen bedecken halb die Namen, dazwischen eine Reihe Trittsteine, die sind wie immer. Ich bleibe stehen und sehe mir die Daten an. 1909 - 1965 und 1911 - 2003. Meine Großmutter hat länger ohne ihren Mann gelebt als mit ihm und starb zehn Tage nach der Hochzeit meiner Schwester. Die Sträucher, die trockene, graue Erde und die in den Stein geschnittenen Zeichen haben nichts mit dem Moment zu tun, als ich zum letzten Mal ihre Hand hielt, ihr durch das wirre, graue Haar strich (wir nannten sie mit dieser Frisur zum Schluss oft scherzhaft "Einstein"), wie ich ihr Herz auf dem Überwachungsmonitor schneller schlagen sah. Sie hat mich gehört und gespürt. Eine Viertelstunde später war sie tot. Das ist dreizehn Jahre her.
Irgendwann taucht ein Friedhofsgärtner auf, grüßt in der bei uns üblichen, wortkargen Art und geht weiter. Ich frage mich, ob ich wohl noch das Grab der Mutter meiner besten Grundschulfreundin finde. Ich frage mich, ob sie selbst wohl noch lebt. Wenn man den Kontakt zu seinen Eltern einstellt, dann funktioniert auch das Buschtelefon nicht mehr. Ich weiß nur, dass diese Freundin die Veranlagung ihrer Mutter zum Brustkrebs erbte.
Ich verlasse den Friedhof. Mir fällt jetzt erst auf, wie klein er ist. Alles ist klein. Das ganze Dorf scheint geschrumpft zu sein. Ich lenke das Auto an der Kirchmauer entlang, auf der wir als Jugendliche oft im Sommer mit baumelnden Beinen gesessen hatten. Der Schaukasten mit den Gemeindemitteilungen steht noch an derselben Stelle, der Rasen sauber gemäht, gebastelte Papierschmetterlinge im Fenster des Gemeindehauses. Die Kneipe am Brunnen hat jetzt einen anderen Namen (ich glaube, sie heißt pfiffigerweise jetzt "Gasthaus am Brunnen"). Das Möbelhaus in Achtzigerjahre-Architektur gegenüber steht immer noch leer. Ein glatzköpfiger Mann mit einem dicken Hund geht das Kopfsteinpflaster hinauf. Im Dönerladen meiner Jugend werden jetzt Blumen verkauft, in der Eisdiele von damals Pizza und Döner. Dinge ändern sich, obwohl sie sich nicht ändern.
Wenn du nicht da bist, während sich die Dinge ändern, dann kommt die Änderung so plötzlich. Ich frage mich, wie vielen alten Menschen es so gehen muss. Häuser werden abgerissen, hochgezogen, Straßen verlegt, und du selbst hast doch nur zehn Jahre nicht hingeschaut, und dann ist alles anders. Dort, wo ich jetzt zuhause bin, ändern sich alles sukzessive. Ich sehe es, kann es greifen, und mein Gedächtnis ist mir treu. Aber dieses Dorf ändert sich nicht nur äußerlich. Meine Distanz ist nicht nur räumlich. Hier und da ein Ankerpunkt, ja. Eine Erinnerung. Oder ein Grab. Verwandte. Eine Durchfahrt. Aber auch die Erinnerungen relativieren sich. All die Kurven, um die ich hunderttausend Mal gebogen bin, haben nur so geringe Bedeutung. Die Türen, vor denen ich gestanden und die Fenster, zu denen ich hinaufgeschaut habe, sind in meinen Tagebüchern lebendiger als in der Wirklichkeit. Die Schleichwege, die ich kannte, sind Kindheitserinnerungen. Es gibt sie nicht mehr.
Es ist auch die eigene Veränderung, oder vielleicht vor allem die, die mich von all dem noch weiter entfernt. Meine Schwester ist oft mit ihren Kindern bei den Großeltern, sie schafft neue, lebendige Verbindungen zu diesem Ort. Ich tue das nicht. Vielleicht gehe ich eines Tages mit meiner Cousine durch das Dorf, meiner Tante, meinem Mann. Vielleicht sogar mit meinem Vater, meiner Mutter. Ich weiß nicht, was noch kommen wird. Vielleicht komme ich auch weiterhin nur selten zurück, und die Wirklichkeit bleibt nurmehr eine Skizze meiner Erinnerung, die entfernte Ähnlichkeit hat. Das Leben ist, wo ich gerade bin.
Meine Oma sieht mich von dem Foto her an, das an der Wand meines Dachzimmers hängt. Sie hat ein Baby auf dem Schoß in einem gelb-roten Frottee-Strampelanzug, und sie hält seine kleine Hand zart zwischen ihren großen, groben Fingern. Mich. Sie hat mich immer gehalten. Die Erinnerung an sie steckt auch in diesem Dorf. Sie steckt in dem alten Haus mit der Schmiede, in dessen Garten ich als ganz kleines Kind auf dem Bauch in der Sonne lag und das schon lange nicht mehr steht. Sie steckt in dem Friseurladen, zu dem ich sie untergehakt begleitete und der schon längst geschlossen hat. Sie steckt in den Einkaufszetteln, die sie schrieb und auf denen jede Woche drei Dosen Kondensmilch standen, so als könne jederzeit eine Konsensmilchknappheit eintreten. In den Zetteln, die ich mitnahm, um für sie einzukaufen bei dem kleinen Spar-Markt, den es schon lange nicht mehr gibt. Sie steckt in der Gartenerde, in die sie säte und die sie mit ihren Holzschuhen sorgfältig festtrat.
Ich höre sie auf Plattdeutsch meinen Namen nennen. Höre sie liebevoll mit dem Hund schimpfen. Sie ist mit dem Ort fest verwoben und mit mir und der Ort mit mir.
Gehen wir weiter.
Samstag, 21. November 2015
Zeitreise
Am 21. Nov 2015 im Topic 'Tiefseetauchen'
Freunde hatten für gestern abend die Idee, auf ein kleines Konzert zu gehen. Zwar fiel ich nachmittags mal in ein tiefes Müdigkeitsloch, eine Tasse Kaffee und der Wunsch nach Abwechslung halfen aber, es zu überwinden.
Wir fuhren in das benachbarte Städtchen, in dessen Jugendzentrum der besagte Bandabend stattfand. Oh! Kaum dem Auto entstiegen fühlte ich mich wie in eine Zeitreise entführt. Ich hatte in diesem Jugendzentrum (und diversen anderen) einen gewissen Teil meiner Freizeit als 15-, 16-, 17jährige verbracht, und die Erinnerungen an diese Zeit kamen wieder auf.
Jugendzentren und Teestuben haben diesen leicht abgegriffenen Charakter, diesen spezifischen Geruch von etwas sehr Vertrautem für mich. Es gab sehr lange kein größeres Highlight in der Woche als den Donnerstag, an dem das Jugendcafé öffnete und wir die Gelegenheit hatten, genussvoll auf durchgesessenen Sofas herumzuhängen, Getränkepreislisten mit Wachsmalkreiden auf Pappen zu malen, Billard zu spielen, zu kickern, Musik zu hören und große Töpfe voll selbstgemachtem Salat oder Gulaschsuppe für die abendliche Verköstigung bereitzustellen. Dazu kam, dass ich einen nicht unerheblichen Anteil der Einrichtungen im Umkreis mit Spraydose und Pinsel "verschönert" habe.
Das Jugendzentrum unseres Ortes und später auch diejenigen der Umgebung waren die Alternativen zur Schule. Dort fanden sich Menschen, die mich willkommen hießen, es gab Möglichkeiten, Anerkennung zu erhalten und akzeptiert zu werden, sich zu engagieren und Aufgaben zu übernehmen und nicht zuletzt auch, die jugendliche "Coolness" auszuleben, nach der man sich damals sehnte.
Das Konzert gestern zauberte die Atmosphäre von damals zurück. Kaffeebecher auf der abgewetzten Theke, die mit Konzert- und Veranstaltungsplakaten tapezierten Wände, die rotbraunen Bodenfliesen, das Publikum - Flash!
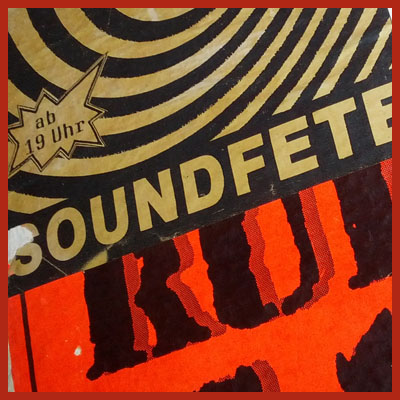
Der Bandabend bot Jugendlichen einer örtlichen Musikschule die Gelegenheit zum Auftritt, und während ich da saß und zu ihrer - zugegebenermaßen bisweilen etwas dissonanten - Musik mit den Füßen wippte, durchschoss mich der Gedanke, dass ich stolz wäre, wären das meine Kinder, die dort aufträten. Stolz auf den Mut und das Selbstvertrauen, die sie an den Tag legten. Nicht etwa musikalische Perfektion machte diesen Abend zu etwas Besonderem, sondern die Präsenz und die Art und Weise, wie sich diese jungen Menschen dort zu zeigen trauten, mit ihrem ganz eigenen Charakter und eigener, hör- und fühlbarer Stimme. Das hat mich sehr berührt.
In dieser lebendig gewordenen Erinnerung fand ich gestern abend ein so ausgeprägtes Wohlgefühl, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt hatte. Das entsprang zum einen sicher dem Ort selbst, mit dem ich positive Erlebnisse verknüpfe. Zum anderen aber auch dem Umstand, dass sich am Ambiente offenbar nichts geändert hat.
Natürlich spüre ich beim Besuch eines solchen Ortes auch das eigene Älterwerden. Es ist in der Tat so, dass manche der musizierenden Kids vom Alter her meine eigenen hätten sein können. Klar, ich trank Wasser, Kaffee und alkoholfreies Bier und hatte vom Stehen irgendwann Rückenschmerzen.

Aber als eine kleine Combo als Zugabe "Smells Like Teen Spirit" spielte, war das vollkommen irrelevant. Nirvana gehörte zum Soundtrack meiner Jugend und hat sich mir - ich will beinahe sagen, epigenetisch - eingeschrieben. Die mit der Musik verknüpfte Erinnerung ist unauslöschbar. Das damit verbundene Gefühl, erstmals in meinem Leben meinen Eigenheiten auf die Spur gekommen zu sein, ebenfalls.
Insofern bleibt auch die neu hinzugefügte Erinnerung an diesen Abend ein Juwel.
Wir fuhren in das benachbarte Städtchen, in dessen Jugendzentrum der besagte Bandabend stattfand. Oh! Kaum dem Auto entstiegen fühlte ich mich wie in eine Zeitreise entführt. Ich hatte in diesem Jugendzentrum (und diversen anderen) einen gewissen Teil meiner Freizeit als 15-, 16-, 17jährige verbracht, und die Erinnerungen an diese Zeit kamen wieder auf.
Jugendzentren und Teestuben haben diesen leicht abgegriffenen Charakter, diesen spezifischen Geruch von etwas sehr Vertrautem für mich. Es gab sehr lange kein größeres Highlight in der Woche als den Donnerstag, an dem das Jugendcafé öffnete und wir die Gelegenheit hatten, genussvoll auf durchgesessenen Sofas herumzuhängen, Getränkepreislisten mit Wachsmalkreiden auf Pappen zu malen, Billard zu spielen, zu kickern, Musik zu hören und große Töpfe voll selbstgemachtem Salat oder Gulaschsuppe für die abendliche Verköstigung bereitzustellen. Dazu kam, dass ich einen nicht unerheblichen Anteil der Einrichtungen im Umkreis mit Spraydose und Pinsel "verschönert" habe.
Das Jugendzentrum unseres Ortes und später auch diejenigen der Umgebung waren die Alternativen zur Schule. Dort fanden sich Menschen, die mich willkommen hießen, es gab Möglichkeiten, Anerkennung zu erhalten und akzeptiert zu werden, sich zu engagieren und Aufgaben zu übernehmen und nicht zuletzt auch, die jugendliche "Coolness" auszuleben, nach der man sich damals sehnte.
Das Konzert gestern zauberte die Atmosphäre von damals zurück. Kaffeebecher auf der abgewetzten Theke, die mit Konzert- und Veranstaltungsplakaten tapezierten Wände, die rotbraunen Bodenfliesen, das Publikum - Flash!
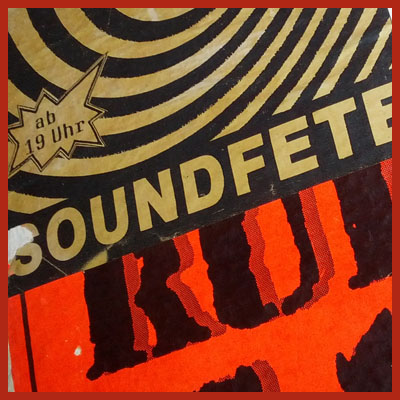
Der Bandabend bot Jugendlichen einer örtlichen Musikschule die Gelegenheit zum Auftritt, und während ich da saß und zu ihrer - zugegebenermaßen bisweilen etwas dissonanten - Musik mit den Füßen wippte, durchschoss mich der Gedanke, dass ich stolz wäre, wären das meine Kinder, die dort aufträten. Stolz auf den Mut und das Selbstvertrauen, die sie an den Tag legten. Nicht etwa musikalische Perfektion machte diesen Abend zu etwas Besonderem, sondern die Präsenz und die Art und Weise, wie sich diese jungen Menschen dort zu zeigen trauten, mit ihrem ganz eigenen Charakter und eigener, hör- und fühlbarer Stimme. Das hat mich sehr berührt.
In dieser lebendig gewordenen Erinnerung fand ich gestern abend ein so ausgeprägtes Wohlgefühl, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt hatte. Das entsprang zum einen sicher dem Ort selbst, mit dem ich positive Erlebnisse verknüpfe. Zum anderen aber auch dem Umstand, dass sich am Ambiente offenbar nichts geändert hat.
Natürlich spüre ich beim Besuch eines solchen Ortes auch das eigene Älterwerden. Es ist in der Tat so, dass manche der musizierenden Kids vom Alter her meine eigenen hätten sein können. Klar, ich trank Wasser, Kaffee und alkoholfreies Bier und hatte vom Stehen irgendwann Rückenschmerzen.

Aber als eine kleine Combo als Zugabe "Smells Like Teen Spirit" spielte, war das vollkommen irrelevant. Nirvana gehörte zum Soundtrack meiner Jugend und hat sich mir - ich will beinahe sagen, epigenetisch - eingeschrieben. Die mit der Musik verknüpfte Erinnerung ist unauslöschbar. Das damit verbundene Gefühl, erstmals in meinem Leben meinen Eigenheiten auf die Spur gekommen zu sein, ebenfalls.
Insofern bleibt auch die neu hinzugefügte Erinnerung an diesen Abend ein Juwel.
Sonntag, 15. November 2015
Inzwischen
Am 15. Nov 2015 im Topic 'Tiefseetauchen'
Die ersten zehn Tage Krankschreibung haben mich davor bewahrt, vollständig zusammenzubrechen. Ich hätte es nicht einen Tag länger ausgehalten, bei der Arbeit zu funktionieren, mich zusammenzureißen und zehneinhalb Stunden täglich durchzuhalten.
Als diese zehn Tage sich dem Ende näherten, wuchs der Kloß in meiner Brust. Ich habe versucht, darüber hinwegzureden, mir einzureden, dass es schon klappen würde. Ich habe versucht, das selber zu glauben. Nachts blieb ich schlaflos, drehte mich von einer Seite auf die andere. Ich hasste mich dafür, nicht schlafen zu können. Hasste mich für meine Angst und Unzulänglichkeit. Schlich aus dem Schlafzimmer, um den Gatten nicht zu wecken. Schlich wieder hinein. Versuchte, die Augen offen zu halten, in der Hoffnung, dadurch müde zu werden. Starrte im Dunkeln die Decke an, ehe die Lider schwer wurden, nur um mich im Kabinett des Grauens wiederzufinden, in dem sich alles nur um die Angst drehte. Unbegründete, begründete Angst. Angst vor Anforderungen, vor Fragen, vor Tränen, vor Lügen, davor, mich selbst zu verlieren.
Ich stand wieder auf. Setzte mich auf das Sofa in meinem Zimmer. Blieb dort ein paar Minuten. Stand wieder auf. Lief im Wohnzimmer auf und ab und betrachtete das orange Licht der Straßenlaternen, dass durch die Ritzen der Jalousie hereinkam. Konnte nicht weinen, trotz der völligen Übermüdung. Ging wieder die Treppe hinauf, setzte mich oben im Flur auf den Teppich und wünschte, ich könnte einfach zu atmen aufhören.
Nebenan schlief der Gatte. Ich versuchte, mir vorzustellen, was ich tun könnte. Hineingehen, ihn wecken, ihm sagen, dass ich nicht mehr kann. Undenkbar. Unzumutbar. Ich bin unzumutbar. Ich kann nicht, ich kann ihn nicht wecken. Ich kann mich ihm nicht zumuten. Hinausgehen aus der hinteren Tür. Runter zum Fluss im Dunkeln.
Ich konnte ihn wecken. Etwas in mir fand, dass ich das kann. Wir sprachen drei Stunden lang, mitten in der Nacht.
Zuzugeben, nicht mehr zu können, fühlte sich an wie eine Kapitulation und tat unendlich weh. Ich sagte es ihm. Dass ich drauf und dran sei, ihn zu bitten, mich in die Psychiatrie zu fahren. Dass ich den Wunsch hätte, alle Kontrolle, allen Willen abzugeben, wenn nur der Schmerz endete.
Am Morgen saß ich in der Praxis meines Hausarztes und tat, wogegen ich mich jahrelang gewehrt habe. Ich bat ihn um medikamentöse Hilfe. Zitternd, erledigt, unsicher und unendlich müde. Er half, so verständnisvoll wie kein Arzt vorher. Er schrieb mich weiter krank und bat mich um telefonischen Kontakt in den folgenden Tagen und Wochen. Ich sprach mit meinem Therapeuten. Ich sprach mit meinem Mann. Meine engsten Freunde fragten immer wieder, wie es mir gehe. Meine Schwiegermutter rief an.
Ich war nicht allein. Auch wenn die Hölle der Depression etwas ist, das niemand so erlebt wie jemand anderes, war ich trotzdem nicht allein. Ich bin den Menschen um mich herum zutiefst dankbar dafür.
Ich atme wieder weiter.
Als diese zehn Tage sich dem Ende näherten, wuchs der Kloß in meiner Brust. Ich habe versucht, darüber hinwegzureden, mir einzureden, dass es schon klappen würde. Ich habe versucht, das selber zu glauben. Nachts blieb ich schlaflos, drehte mich von einer Seite auf die andere. Ich hasste mich dafür, nicht schlafen zu können. Hasste mich für meine Angst und Unzulänglichkeit. Schlich aus dem Schlafzimmer, um den Gatten nicht zu wecken. Schlich wieder hinein. Versuchte, die Augen offen zu halten, in der Hoffnung, dadurch müde zu werden. Starrte im Dunkeln die Decke an, ehe die Lider schwer wurden, nur um mich im Kabinett des Grauens wiederzufinden, in dem sich alles nur um die Angst drehte. Unbegründete, begründete Angst. Angst vor Anforderungen, vor Fragen, vor Tränen, vor Lügen, davor, mich selbst zu verlieren.
Ich stand wieder auf. Setzte mich auf das Sofa in meinem Zimmer. Blieb dort ein paar Minuten. Stand wieder auf. Lief im Wohnzimmer auf und ab und betrachtete das orange Licht der Straßenlaternen, dass durch die Ritzen der Jalousie hereinkam. Konnte nicht weinen, trotz der völligen Übermüdung. Ging wieder die Treppe hinauf, setzte mich oben im Flur auf den Teppich und wünschte, ich könnte einfach zu atmen aufhören.
Nebenan schlief der Gatte. Ich versuchte, mir vorzustellen, was ich tun könnte. Hineingehen, ihn wecken, ihm sagen, dass ich nicht mehr kann. Undenkbar. Unzumutbar. Ich bin unzumutbar. Ich kann nicht, ich kann ihn nicht wecken. Ich kann mich ihm nicht zumuten. Hinausgehen aus der hinteren Tür. Runter zum Fluss im Dunkeln.
Ich konnte ihn wecken. Etwas in mir fand, dass ich das kann. Wir sprachen drei Stunden lang, mitten in der Nacht.
Zuzugeben, nicht mehr zu können, fühlte sich an wie eine Kapitulation und tat unendlich weh. Ich sagte es ihm. Dass ich drauf und dran sei, ihn zu bitten, mich in die Psychiatrie zu fahren. Dass ich den Wunsch hätte, alle Kontrolle, allen Willen abzugeben, wenn nur der Schmerz endete.
Am Morgen saß ich in der Praxis meines Hausarztes und tat, wogegen ich mich jahrelang gewehrt habe. Ich bat ihn um medikamentöse Hilfe. Zitternd, erledigt, unsicher und unendlich müde. Er half, so verständnisvoll wie kein Arzt vorher. Er schrieb mich weiter krank und bat mich um telefonischen Kontakt in den folgenden Tagen und Wochen. Ich sprach mit meinem Therapeuten. Ich sprach mit meinem Mann. Meine engsten Freunde fragten immer wieder, wie es mir gehe. Meine Schwiegermutter rief an.
Ich war nicht allein. Auch wenn die Hölle der Depression etwas ist, das niemand so erlebt wie jemand anderes, war ich trotzdem nicht allein. Ich bin den Menschen um mich herum zutiefst dankbar dafür.
Ich atme wieder weiter.
Samstag, 17. Oktober 2015
Revision
Am 17. Okt 2015 im Topic 'Tiefseetauchen'
Dieses Blog existiert jetzt seit beinahe sieben Jahren. Es hat mich als virtuelles, öffentliches Tagebuch lange begleitet und viele Menschen haben hier ihre interessanten, streitbaren, ermutigenden Kommentare hinterlassen. Das macht das Blog und das Bloggen für mich zu einer lebendigen Angelegenheit, die ich in dieser langen Zeit sehr genossen habe. Geärgert habe ich mich auch ab und zu, oder den Sinn des Bloggens angezweifelt.
Manchmal fiel mir gar nichts ein, es hatte sich einfach nicht ergeben, in mir brannte gerade kein Thema, kein Gefühl, nichts, das hier in Worte gefasst hätte werden müssen. Ich habe mir Blogpausen erlaubt, wenn sie nötig waren. Oft war ich auch zu sehr mit Leben beschäftigt.
Das klingt vielleicht sehr nach einem abschließenden Resümee. Es ist zumindest ein zwischenzeitliches. Ich habe nicht vor, dieses Blog zu schließen, stelle aber fest, dass es mir in letzter Zeit schwer fällt, zu schreiben.
Tagebuch und Bleistift leisten mir momentan ausgezeichnete Dienste, um meine Gedanken zu sortieren. Sie haben den Vorteil, verschwiegener und weniger öffentlich zu sein. Ich schrieb hier darüber, wieder in Therapie zu sein, und in den letzten Wochen habe ich definitiv absolute Tiefpunkte erlebt. Eine Depression lässt sich nicht schildern. Man kann nur diejenigen Menschen beglückwünschen, die das in ihrem Leben niemals erleben müssen.
Mir war Authentizität immer wichtig beim Bloggen. Mich zu verstellen, etwas vorzuspiegeln, was ich nicht bin, nur um mich und mein Geschriebenes interessant für andere zu machen und dafür Applaus zu ernten, ist schlicht und ergreifend nicht mein Ding. Ich wollte nie drastisch und mit pseudo-coolen Kraftausdrücken schreiben, nur um der Aufmerksamkeit willen. Ich wollte aber meine eigene Verletzlichkeit auch nie verstecken. Was hier lesbar ist, ist ein Teil von mir, der echt ist und aufrichtig. Trotzdem ist eben jene Verletzlichkeit auch ein Schwachpunkt. Wenn die Haut zu nackt und zu weich ist und man nicht für und um jedes Wort kämpfen kann, ist es wieder mal Zeit, das Schreiben für eine Weile bleiben zu lassen. Das Wichtigste ist dann allein das Weiteratmen.
Diese Weile ist auch ein guter Zeitraum, um neu auszuloten, ob und was mir das Schreiben hier bedeutet. Vielleicht ändert sich nichts, vielleicht etwas, vielleicht alles. Ich weiß es noch nicht. Fest steht, dass sich im "wahren" Leben gerade eine Menge ändert, meine Empfindungen sich wandeln, die eigene Einstellung zu Menschen und Gefühlen. Perspektiven. Vielleicht wird es hier irgendwann etwas darüber zu lesen geben. Möglicherweise auch nicht. Das wird sich erweisen müssen.
Manchmal fiel mir gar nichts ein, es hatte sich einfach nicht ergeben, in mir brannte gerade kein Thema, kein Gefühl, nichts, das hier in Worte gefasst hätte werden müssen. Ich habe mir Blogpausen erlaubt, wenn sie nötig waren. Oft war ich auch zu sehr mit Leben beschäftigt.
Das klingt vielleicht sehr nach einem abschließenden Resümee. Es ist zumindest ein zwischenzeitliches. Ich habe nicht vor, dieses Blog zu schließen, stelle aber fest, dass es mir in letzter Zeit schwer fällt, zu schreiben.
Tagebuch und Bleistift leisten mir momentan ausgezeichnete Dienste, um meine Gedanken zu sortieren. Sie haben den Vorteil, verschwiegener und weniger öffentlich zu sein. Ich schrieb hier darüber, wieder in Therapie zu sein, und in den letzten Wochen habe ich definitiv absolute Tiefpunkte erlebt. Eine Depression lässt sich nicht schildern. Man kann nur diejenigen Menschen beglückwünschen, die das in ihrem Leben niemals erleben müssen.
Mir war Authentizität immer wichtig beim Bloggen. Mich zu verstellen, etwas vorzuspiegeln, was ich nicht bin, nur um mich und mein Geschriebenes interessant für andere zu machen und dafür Applaus zu ernten, ist schlicht und ergreifend nicht mein Ding. Ich wollte nie drastisch und mit pseudo-coolen Kraftausdrücken schreiben, nur um der Aufmerksamkeit willen. Ich wollte aber meine eigene Verletzlichkeit auch nie verstecken. Was hier lesbar ist, ist ein Teil von mir, der echt ist und aufrichtig. Trotzdem ist eben jene Verletzlichkeit auch ein Schwachpunkt. Wenn die Haut zu nackt und zu weich ist und man nicht für und um jedes Wort kämpfen kann, ist es wieder mal Zeit, das Schreiben für eine Weile bleiben zu lassen. Das Wichtigste ist dann allein das Weiteratmen.
Diese Weile ist auch ein guter Zeitraum, um neu auszuloten, ob und was mir das Schreiben hier bedeutet. Vielleicht ändert sich nichts, vielleicht etwas, vielleicht alles. Ich weiß es noch nicht. Fest steht, dass sich im "wahren" Leben gerade eine Menge ändert, meine Empfindungen sich wandeln, die eigene Einstellung zu Menschen und Gefühlen. Perspektiven. Vielleicht wird es hier irgendwann etwas darüber zu lesen geben. Möglicherweise auch nicht. Das wird sich erweisen müssen.
Freitag, 25. September 2015
Nützlich
Am 25. Sep 2015 im Topic 'Tiefseetauchen'
Den eigenen Geburtstag herbeizusehnen ist ein Gefühlszustand, der mir irgendwann in der Teenagerzeit vollständig abhanden gekommen ist. Vielleicht liegt es am Älterwerden und daran, dass man sich daran gewöhnt. Es könnte auch sein, dass man allmählich begreift, Geburtstage fühlen sich auch nicht anders an als andere.
In meiner Kinderzeit war da noch die Freude über den Umstand, dass man Wünsche äußern durfte, die dann manchmal auch erfüllt wurden. Meine Mutter dekorierte sorgfältig den Frühstückstisch. Sie umrahmte mein rundes Frühstücksbrett mit Teelichten und Blumen. Mein Vater spielte zum Wecken von außen am Türrahmen meines Zimmers die kleine Drehorgel mit "Happy Birthday", die er tags zuvor heimlich aus meinem Setzkasten genommen hatte (als hätte ich das nicht bemerkt).
Es steckt mir in den Knochen, vorwegnehmend auf die Erwartungen anderer zu reagieren, und so war das auch immer im Zusammenhang mit Geburtstagen. Ich dosierte sehr angemessen die Freude, die über ein Geschenk erwartet wurde, sagte artig danke (auch mit 15, 16, 18, 20 Jahren). Dass das jedweder Art von wirklicher, aufrichtiger Freude den Garaus machte, brauche ich wohl nicht wirklich zu erwähnen.
Meine Geburtstage waren komplexbeladen. Im Mittelpunkt zu stehen, ohne das verdient zu haben, war mir immer massivst unangenehm. Woher die Verknüpfung "Geburtstag" und "Verdienthaben" kam? Ich habe eine Menge Vermutungen hierzu. Ich habe irgendwann aufgehört, meinem Geburtstag überhaupt große Beachtung zu schenken. Wie erbringt man die Gegenleistung für's Geborenwerden? Ich stand knietief in der Schuld - in ihrer Schuld.
Da sind Freunde, die jedes Jahr ihre Gratulation einleiten mit den Worten "Ich weiß, Du legst nicht so viel Wert darauf, aber trotzdem...!". Ich begreife plötzlich, dass diese Menschen mir gerne sagen möchten, sie freuen sich, dass es mich gibt. Mein Dank an sie kann endlich aufrichtig sein, keine Pflichtleistung, keine Entschädigung dafür, dass sie sich mit mir auseinandergesetzt haben. Dieser Dank steht für sich. Er genügt aber auch.
Es ist eine verdrehte Welt in meinem Inneren, die noch mehr als ich ahnte von Selbstverachtung geprägt ist. Ich bin bisweilen erschüttert darüber, häufiger jedoch ist mir das vollkommen unhinterfragte Gewohnheit. Noch, wage ich zu sagen. Gerade bricht eine Schale auf.
Seit Ende 2008 habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Zum Teil habe ich mir auch Geburtstagsgeschenke verbeten und wieder zurückgeschickt. Sie haben dann Formen gefunden, mich dennoch zu beschenken, wie beispielsweise mit dem Zeitungsabonnement. In diesem Jahr kam ein Taschenkalender mit dem Titel "Zeit für Neues". Das hätte ihnen so gut gefallen, schreibt meine Mutter dazu in eine Klappkarte. Und möglicherweise könne man sich ja mal zu einem Plauderstündchen treffen. Und übrigens habe sie jetzt auch ein i-Phone. Die Nummer notierte sie dazu.
Zeit für Neues. In ihrem Leben hat sich sicher einiges verändert, seit wir uns zum letzten Mal wirklich gesehen haben. In meinem auch. Ich begreife den dringlichen Wunsch hinter ihren Worten. Ihre Nachrichten waren noch nie ohne Subtext und sind es auch dieses Mal nicht. "Bitte erlaube uns, Dich wiederzusehen. Wir müssen uns auch über nichts Gravierendes unterhalten! Schaffe eine neue Verbindung!" Ich verstehe die Hilflosigkeit, die darin steckt. Das bedeutet nicht, dass ich entsprechend handeln werde.
Was ich spüre ist, dass sie mich brauchen. Ich überlege, wie das mit anderen Menschen ist, die um mich sind. Natürlich braucht jede/r von uns, so wie wir miteinander sind, immer auch wieder einen Freund, ein offenes Ohr, Rückhalt, Freude aneinander, Freundschaft eben. Aber Freunde sind nicht wie Eltern. Meine Eltern hatten immer den Anspruch, einmal zu unseren Freunden zu werden. Besonders mein Vater hat das immer wieder betont. Ich halte das für unmöglich. Die Art, auf die mich meine Eltern brauchen, ist völlig anders als die Art, wie sich Freunde brauchen.
Ich bin übersensibel geworden für die Bedürfnisse meiner Eltern. Ich habe mir in meinem Leben so viel Scheiß von ihnen anhören dürfen. Erst aus der dringend nötigen Distanz heraus kann ich begreifen, wie missbräuchlich dieses Verhältnis eigentlich wirklich war. Ich war ihre Bühne, ihre Projektionsfläche, ihr Blitzableiter. Ich war Wärmespender, Nähegarant, sexuelles Objekt. Ich war Kummerkastentante und Küchenpsychologin, Telefontrösterin, Mülleimer. Ich war ihre Traumleinwand, ihr Ersatz für ungelebte eigene Ziele. Ich war ihr Kumpel, ihr Sohn, ihr Spiegelbild. Ich war ihr Sorgenkind, damit sie die eigenen Probleme nicht sehen mussten. Das alles war zwar nicht der Grund, aus dem sie mich in die Welt gesetzt haben. Aber es war mein Zweck.
Überzeuge jemanden, den Du eigentlich nur benutzt, wenn Du ihn brauchst, davon, dass er Dir etwas bedeutet.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Schön, dass es Dich gibt!
In meiner Kinderzeit war da noch die Freude über den Umstand, dass man Wünsche äußern durfte, die dann manchmal auch erfüllt wurden. Meine Mutter dekorierte sorgfältig den Frühstückstisch. Sie umrahmte mein rundes Frühstücksbrett mit Teelichten und Blumen. Mein Vater spielte zum Wecken von außen am Türrahmen meines Zimmers die kleine Drehorgel mit "Happy Birthday", die er tags zuvor heimlich aus meinem Setzkasten genommen hatte (als hätte ich das nicht bemerkt).
Es steckt mir in den Knochen, vorwegnehmend auf die Erwartungen anderer zu reagieren, und so war das auch immer im Zusammenhang mit Geburtstagen. Ich dosierte sehr angemessen die Freude, die über ein Geschenk erwartet wurde, sagte artig danke (auch mit 15, 16, 18, 20 Jahren). Dass das jedweder Art von wirklicher, aufrichtiger Freude den Garaus machte, brauche ich wohl nicht wirklich zu erwähnen.
Meine Geburtstage waren komplexbeladen. Im Mittelpunkt zu stehen, ohne das verdient zu haben, war mir immer massivst unangenehm. Woher die Verknüpfung "Geburtstag" und "Verdienthaben" kam? Ich habe eine Menge Vermutungen hierzu. Ich habe irgendwann aufgehört, meinem Geburtstag überhaupt große Beachtung zu schenken. Wie erbringt man die Gegenleistung für's Geborenwerden? Ich stand knietief in der Schuld - in ihrer Schuld.
Da sind Freunde, die jedes Jahr ihre Gratulation einleiten mit den Worten "Ich weiß, Du legst nicht so viel Wert darauf, aber trotzdem...!". Ich begreife plötzlich, dass diese Menschen mir gerne sagen möchten, sie freuen sich, dass es mich gibt. Mein Dank an sie kann endlich aufrichtig sein, keine Pflichtleistung, keine Entschädigung dafür, dass sie sich mit mir auseinandergesetzt haben. Dieser Dank steht für sich. Er genügt aber auch.
Es ist eine verdrehte Welt in meinem Inneren, die noch mehr als ich ahnte von Selbstverachtung geprägt ist. Ich bin bisweilen erschüttert darüber, häufiger jedoch ist mir das vollkommen unhinterfragte Gewohnheit. Noch, wage ich zu sagen. Gerade bricht eine Schale auf.
Seit Ende 2008 habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Zum Teil habe ich mir auch Geburtstagsgeschenke verbeten und wieder zurückgeschickt. Sie haben dann Formen gefunden, mich dennoch zu beschenken, wie beispielsweise mit dem Zeitungsabonnement. In diesem Jahr kam ein Taschenkalender mit dem Titel "Zeit für Neues". Das hätte ihnen so gut gefallen, schreibt meine Mutter dazu in eine Klappkarte. Und möglicherweise könne man sich ja mal zu einem Plauderstündchen treffen. Und übrigens habe sie jetzt auch ein i-Phone. Die Nummer notierte sie dazu.
Zeit für Neues. In ihrem Leben hat sich sicher einiges verändert, seit wir uns zum letzten Mal wirklich gesehen haben. In meinem auch. Ich begreife den dringlichen Wunsch hinter ihren Worten. Ihre Nachrichten waren noch nie ohne Subtext und sind es auch dieses Mal nicht. "Bitte erlaube uns, Dich wiederzusehen. Wir müssen uns auch über nichts Gravierendes unterhalten! Schaffe eine neue Verbindung!" Ich verstehe die Hilflosigkeit, die darin steckt. Das bedeutet nicht, dass ich entsprechend handeln werde.
Was ich spüre ist, dass sie mich brauchen. Ich überlege, wie das mit anderen Menschen ist, die um mich sind. Natürlich braucht jede/r von uns, so wie wir miteinander sind, immer auch wieder einen Freund, ein offenes Ohr, Rückhalt, Freude aneinander, Freundschaft eben. Aber Freunde sind nicht wie Eltern. Meine Eltern hatten immer den Anspruch, einmal zu unseren Freunden zu werden. Besonders mein Vater hat das immer wieder betont. Ich halte das für unmöglich. Die Art, auf die mich meine Eltern brauchen, ist völlig anders als die Art, wie sich Freunde brauchen.
Ich bin übersensibel geworden für die Bedürfnisse meiner Eltern. Ich habe mir in meinem Leben so viel Scheiß von ihnen anhören dürfen. Erst aus der dringend nötigen Distanz heraus kann ich begreifen, wie missbräuchlich dieses Verhältnis eigentlich wirklich war. Ich war ihre Bühne, ihre Projektionsfläche, ihr Blitzableiter. Ich war Wärmespender, Nähegarant, sexuelles Objekt. Ich war Kummerkastentante und Küchenpsychologin, Telefontrösterin, Mülleimer. Ich war ihre Traumleinwand, ihr Ersatz für ungelebte eigene Ziele. Ich war ihr Kumpel, ihr Sohn, ihr Spiegelbild. Ich war ihr Sorgenkind, damit sie die eigenen Probleme nicht sehen mussten. Das alles war zwar nicht der Grund, aus dem sie mich in die Welt gesetzt haben. Aber es war mein Zweck.
Überzeuge jemanden, den Du eigentlich nur benutzt, wenn Du ihn brauchst, davon, dass er Dir etwas bedeutet.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Schön, dass es Dich gibt!
Donnerstag, 17. September 2015
Über Masken
Am 17. Sep 2015 im Topic 'Tiefseetauchen'
In mir ist dieses Gefühl, einen erheblichen Teil meiner Zeit nicht ich selbst sein zu können. Ich spiele jemanden. Ich bin nur, wenn ich allein bin, in Gegenwart des Gatten oder sehr vertrauter Freunde. Aber auch dann habe ich oft eine Instanz in mir, die mir permanent sagt, wie ich sein sollte. Was ich bräuchte statt dessen wäre jemand in mir, der mich ermutigt, die zu sein, die ich sein könnte und will.
Die Maske, die ich ich trage ist die eines Menschen, der anpacken kann, der alles schafft, immer souverän ist. Der Aufgaben vorausahnt, ehe sie gestellt werden und der zuverlässig immer präsent ist. Nicht jammert. Auf gar keinen Fall. Aber das ist eben nur eine Maske. Wenn ich sie trage, dann verwandelt sich mein Ich nicht in Wonderwoman, sondern in ein ziemlich ignorantes Schwein, dass zwar alle Anforderungen von außen nach Kräften bedient, aber völlig das Gespür verliert für alle Gefühle und Bedürfnisse im Inneren. Es ist also kein Wunder, wenn das Innere sich gegen den ihm aufgezwungenen Zerfall sträubt, so gut es das kann.
Nach einem Tag Berufsschule, die ich im Gegensatz zu meinem Mitauszubildenden immerhin noch regelmäßig besuche, stapelte sich auf meinem Tisch und im Maileingang all das, was man offenbar nicht ohne mich erledigen konnte. Der Kollege überschwemmte mich mit Wichtigkeiten, die keinen Aufschub duldeten, während ich mich noch nicht einmal richtig sortiert hatte. Dies und das und jenes noch, alles ganz dringend, alles sofort. Nichts war selbständig erledigt worden.
Menschen, die einen Overload kennen, werden in etwa nachfühlen können, was ich in dem Moment erlebt habe. Der Kopf wie Watte, kein klarer Gedanke mehr, nur noch zu viel, zu viel.
Ich landete auf dem Klo, zog die Tür hinter mir zu und ließ lautlos die Tränen laufen. Fühlte mich so hoffnungslos, unfähig zu irgendeiner sinnvollen Handlung, einfach nur fertig.
Immerzu antworte ich: "Ich kümmere mich darum!", "Du hast das in zehn Minuten!" "Ich schaue gleich mal!" Mein Inneres schreit, aber das Äußere schreit noch lauter, und Neinsagen geht nicht. Denn was mir dann geschähe, das ist gefühlt schlimmer als alle innerlichen Zusammenbrüche. Missbilligung. Man könnte mich für schwach halten. Unbelastbar. Unzuverlässig. Mir meine Fehler vorwerfen.
Jetzt: Krankschreibung für zehn Tage. Ich habe mir das herausgenommen. Andere sehen, wie mies es mir geht, aber ich selbst konnte das bis jetzt nicht. Giving up is not an option! Die Firma fordert Überstunden, dazu Samstagsarbeit auf "freiwilliger" Basis (als sei bei dem Gruppendruck irgendwas freiwillig). Ich spüre, wie mich das Nachlassen des Drucks erleichtert. Wie gut es tut, dass mir der Arzt sagt: "Ich sehe ja, dass es Ihnen nicht gut geht!" Wie entlastend es ist, einzugestehen, dass ich an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit geraten bin und mit Zusammenreißen nichts mehr zu machen ist.
Die Maske trage ich dennoch. Ich habe sorgfältig darauf geachtet, den Personalchef von meiner Krankschreibung per Mail in Kenntnis zu setzen, damit keine Rückfragen kommen, was ich denn habe. Es gibt Gründe, die gelten, und welche, die nicht gelten. Man muss nicht lange dabei sein, um das zu wissen. In meinem Kopf formulieren sich Entgegnungen auf Nachfragen. Und am liebsten möchte ich sagen: "Aus Gründen!" Diese Auskunft sollte reichen.
Leider ist es so, dass seelische Belastungen und Krankheiten längst nicht die Anerkennung genießen wie eine deftige Magen-Darm-Grippe mit Scheißerei und großem Kotzen. Nicht nur Außenstehende, auch mein eigenes inneres Bewertungssystem stempelt ein seelisches Nicht-Können als ein Nicht-Wollen, als Faulheit, als Verweigerung ab.
Trotzdem bin ich froh, dass ich den Schritt der Krankschreibung gegangen bin. Denn es gibt kein Limit, bei dem der Arbeitgeber einem sagt: "Jetzt hast Du genug getan, ruh Dich mal aus!" Es gibt keine Feierstunde mit Ordensverleihung für die geleisteten Überstunden (im Gegenteil, man kann froh und dankbar sein, wenn man dazu kommt, sie abzufeiern). Es gibt keine Fleißkärtchen, keine Boni, kein Dankeschön. Im Gegenteil, ich signalisierte bislang, dass man's mit mir machen kann.
Jetzt geht es nicht mehr. Und ich muss mir gründlich überlegen, wie ich weitermache, wenn diese zehn Tage um sind. Ob und wie ich meine Maske tragen will. Auch, ob ich das nach meinem Ausbildungs-Abschluss weiter machen möchte.
"Wer Stress hat, ist bloß schlecht organisiert!" - Das sagte vor einiger Zeit mein junger Mitauszubildender. Inzwischen rotiert er vor Stress, macht immer mehr Fehler, weiß nicht mehr, welches Ende er zuerst anfassen soll. Natürlich, denn das ist die logische Konsequenz permanenter Überbelastung. Aber an seinem Satz kann man ganz gut ablesen, wie wenig gern gesehen es generell ist, irgendeine menschliche Regung zu zeigen. Er sieht es auch an sich selbst nicht gern. Genau wie ich.
Ich bezweifle, dass meinem Arbeitgeber und meinen Vorgesetzten irgendein Erkenntnisgewinn aus meiner Krankschreibung erwächst. Aber ich selbst werde kurz- und mittelfristig irgendwie für Entlastung sorgen müssen. Das Schwierigste dabei ist wohl das zumindest zeitweilige Ablegen der Maske, das Zeigen des wahren Gesichts meiner menschlichen Schwäche.
Als ich aus dem Klo wieder heraustrat und meine verschmierte Wimperntusche sah, wusch ich mir das Gesicht. Meine zuvor sorgfältig abgedeckten dunklen Augenringe kamen zum Vorschein, ich sah unendlich erledigt aus.
Das alles ist, wer ich gerade bin, aber ich habe es wochen- und monatelang gut versteckt. Diese Maske ist gefallen, man sieht mein fahles Gesicht, die müden Augen.
Mindestens bin ich es mir schuldig, das selbst anzusehen. Es anderen gegenüber einzugestehen und Grenzen deutlich zu machen ist ein sehr großes Wagnis, von dem ich noch nicht weiß, wie ich es eingehen kann. Aber wenn alles in mir sagt, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dann wird es vermutlich Zeit. Denn alternativ bleibt nur noch die Selbstzerstörung.
Die Maske, die ich ich trage ist die eines Menschen, der anpacken kann, der alles schafft, immer souverän ist. Der Aufgaben vorausahnt, ehe sie gestellt werden und der zuverlässig immer präsent ist. Nicht jammert. Auf gar keinen Fall. Aber das ist eben nur eine Maske. Wenn ich sie trage, dann verwandelt sich mein Ich nicht in Wonderwoman, sondern in ein ziemlich ignorantes Schwein, dass zwar alle Anforderungen von außen nach Kräften bedient, aber völlig das Gespür verliert für alle Gefühle und Bedürfnisse im Inneren. Es ist also kein Wunder, wenn das Innere sich gegen den ihm aufgezwungenen Zerfall sträubt, so gut es das kann.
Nach einem Tag Berufsschule, die ich im Gegensatz zu meinem Mitauszubildenden immerhin noch regelmäßig besuche, stapelte sich auf meinem Tisch und im Maileingang all das, was man offenbar nicht ohne mich erledigen konnte. Der Kollege überschwemmte mich mit Wichtigkeiten, die keinen Aufschub duldeten, während ich mich noch nicht einmal richtig sortiert hatte. Dies und das und jenes noch, alles ganz dringend, alles sofort. Nichts war selbständig erledigt worden.
Menschen, die einen Overload kennen, werden in etwa nachfühlen können, was ich in dem Moment erlebt habe. Der Kopf wie Watte, kein klarer Gedanke mehr, nur noch zu viel, zu viel.
Ich landete auf dem Klo, zog die Tür hinter mir zu und ließ lautlos die Tränen laufen. Fühlte mich so hoffnungslos, unfähig zu irgendeiner sinnvollen Handlung, einfach nur fertig.
Immerzu antworte ich: "Ich kümmere mich darum!", "Du hast das in zehn Minuten!" "Ich schaue gleich mal!" Mein Inneres schreit, aber das Äußere schreit noch lauter, und Neinsagen geht nicht. Denn was mir dann geschähe, das ist gefühlt schlimmer als alle innerlichen Zusammenbrüche. Missbilligung. Man könnte mich für schwach halten. Unbelastbar. Unzuverlässig. Mir meine Fehler vorwerfen.
Jetzt: Krankschreibung für zehn Tage. Ich habe mir das herausgenommen. Andere sehen, wie mies es mir geht, aber ich selbst konnte das bis jetzt nicht. Giving up is not an option! Die Firma fordert Überstunden, dazu Samstagsarbeit auf "freiwilliger" Basis (als sei bei dem Gruppendruck irgendwas freiwillig). Ich spüre, wie mich das Nachlassen des Drucks erleichtert. Wie gut es tut, dass mir der Arzt sagt: "Ich sehe ja, dass es Ihnen nicht gut geht!" Wie entlastend es ist, einzugestehen, dass ich an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit geraten bin und mit Zusammenreißen nichts mehr zu machen ist.
Die Maske trage ich dennoch. Ich habe sorgfältig darauf geachtet, den Personalchef von meiner Krankschreibung per Mail in Kenntnis zu setzen, damit keine Rückfragen kommen, was ich denn habe. Es gibt Gründe, die gelten, und welche, die nicht gelten. Man muss nicht lange dabei sein, um das zu wissen. In meinem Kopf formulieren sich Entgegnungen auf Nachfragen. Und am liebsten möchte ich sagen: "Aus Gründen!" Diese Auskunft sollte reichen.
Leider ist es so, dass seelische Belastungen und Krankheiten längst nicht die Anerkennung genießen wie eine deftige Magen-Darm-Grippe mit Scheißerei und großem Kotzen. Nicht nur Außenstehende, auch mein eigenes inneres Bewertungssystem stempelt ein seelisches Nicht-Können als ein Nicht-Wollen, als Faulheit, als Verweigerung ab.
Trotzdem bin ich froh, dass ich den Schritt der Krankschreibung gegangen bin. Denn es gibt kein Limit, bei dem der Arbeitgeber einem sagt: "Jetzt hast Du genug getan, ruh Dich mal aus!" Es gibt keine Feierstunde mit Ordensverleihung für die geleisteten Überstunden (im Gegenteil, man kann froh und dankbar sein, wenn man dazu kommt, sie abzufeiern). Es gibt keine Fleißkärtchen, keine Boni, kein Dankeschön. Im Gegenteil, ich signalisierte bislang, dass man's mit mir machen kann.
Jetzt geht es nicht mehr. Und ich muss mir gründlich überlegen, wie ich weitermache, wenn diese zehn Tage um sind. Ob und wie ich meine Maske tragen will. Auch, ob ich das nach meinem Ausbildungs-Abschluss weiter machen möchte.
"Wer Stress hat, ist bloß schlecht organisiert!" - Das sagte vor einiger Zeit mein junger Mitauszubildender. Inzwischen rotiert er vor Stress, macht immer mehr Fehler, weiß nicht mehr, welches Ende er zuerst anfassen soll. Natürlich, denn das ist die logische Konsequenz permanenter Überbelastung. Aber an seinem Satz kann man ganz gut ablesen, wie wenig gern gesehen es generell ist, irgendeine menschliche Regung zu zeigen. Er sieht es auch an sich selbst nicht gern. Genau wie ich.
Ich bezweifle, dass meinem Arbeitgeber und meinen Vorgesetzten irgendein Erkenntnisgewinn aus meiner Krankschreibung erwächst. Aber ich selbst werde kurz- und mittelfristig irgendwie für Entlastung sorgen müssen. Das Schwierigste dabei ist wohl das zumindest zeitweilige Ablegen der Maske, das Zeigen des wahren Gesichts meiner menschlichen Schwäche.
Als ich aus dem Klo wieder heraustrat und meine verschmierte Wimperntusche sah, wusch ich mir das Gesicht. Meine zuvor sorgfältig abgedeckten dunklen Augenringe kamen zum Vorschein, ich sah unendlich erledigt aus.
Das alles ist, wer ich gerade bin, aber ich habe es wochen- und monatelang gut versteckt. Diese Maske ist gefallen, man sieht mein fahles Gesicht, die müden Augen.
Mindestens bin ich es mir schuldig, das selbst anzusehen. Es anderen gegenüber einzugestehen und Grenzen deutlich zu machen ist ein sehr großes Wagnis, von dem ich noch nicht weiß, wie ich es eingehen kann. Aber wenn alles in mir sagt, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dann wird es vermutlich Zeit. Denn alternativ bleibt nur noch die Selbstzerstörung.
Montag, 3. August 2015
Friesland: Befindlichkeiten
Am 3. Aug 2015 im Topic 'Tiefseetauchen'
Nur weil man Urlaub hat, muss es einem noch lange nicht gut gehen. Das ist das Schwierige an der Depression. Außenstehende bewerten die Lage oft mit den Worten "Die hat doch alles...!" oder "Es geht ihr doch gut, warum also...?"
Nach Wochen und Wochen der Plackerei, nach Überstunden, Stress und Großprojekten vierzehn Tage Urlaub zu haben, sollte mich ja eigentlich in einen Zustand des Glücks versetzen. Endlich habe ich die Freiheit, zu tun, was ich will, Freiheit von der Stempeluhr, Freiheit von Alltagssorgen, die Freiheit, über meine eigene Zeit zu bestimmen und hinzugehen, wo ich will, wann ich es will. Ganz so einfach ist es aber nicht.
Auch wenn ich verreise, reist die Depression mit mir. Das Harte, Alte, Dunkle greift nach mir, und es kommt zuverlässig. Es begreift nicht, dass vierzehn Tage lang alles anders sein soll als sonst.
Unterwegs auf meinen eigenen zwei Beinen besteht aber der Unterschied darin, dass ich mich nicht verkriechen kann und dass bestimmte Notwendigkeiten mich dazu zwingen, neue Erfahrungen zu machen. Möglich, dass genau das der Grund war, allein und zu Fuß zu gehen. Großartige Erkenntnisse kommen einem nicht, auch nicht auf so einer Reise. Es ist nicht so, dass man beim letzten Schritt noch depressiv war und es beim nächsten nicht mehr ist, und dass Erleuchtung vom Himmel fiele.
In meinem Leben war ich schon oft einfach mit Aushalten beschäftigt. Weiteratmen. Natürlich auch mit der in meinem Kopf rasenden Analyse der Dinge. Wieso geht es mir jetzt schlecht? Ich habe doch alles.... Genau. Immer braucht alles einen Grund.
Es war am Abend meines ersten Tages in Friesland, als es mir am schlimmsten ging. Meine Depression hält sich normalerweise hauptsächlich in den eigenen vier Wänden auf - ich weiß nicht, wievielen anderen Menschen es noch so gehen mag. Sie ist eine Krankheit des Verharrens. Verharren ist aber nicht möglich, wenn man unterwegs ist. Meine Gefühle kondensierten an der Oberfläche dessen, was mir begegnete. Das Schöne und das Schreckliche sind dabei so dicht beieinander, dass es beinahe unglaubwürdig wirkt.
Als ich heulend an der Nordseeküste entlanglief, waren das Tränen von Glück und Lebendigkeit. Ich war einfach da, atmete die salzige Luft, sah das Glitzern auf dem Wasser und machte mir noch keine Sorgen um später.
Später, auf einem Luftbett in einer Kammer liegend, die die Betreiberin meines ersten Campingplatzes für mich hergerichtet hatte, hätte ich mich eigentlich heimelig und wohl fühlen können. Um nicht missverstanden zu werden - ich war zutiefst dankbar. Dafür, einem Menschen begegnet zu sein, der mir ein festes Dach über dem Kopf anbot, während es draußen stürmte und regnete, und der das ohne viel Aufhebens und mit großer Freundlichkeit tat. Ich hätte so bleiben können - dankbar, warm, behaglich. Aber das ging nicht.
Am schwersten in meinem Rucksack wogen nicht das Zelt und nicht das Trinkwasser. Am schwersten wog, was mich immer begleitet: die Dunkelheit. Diese Dunkelheit spricht.
Wenn Dich jetzt dieser junge Mann nicht im Auto mitgenommen hätte, dann hättest Du das heute gar nicht schaffen können.
Wenn Dich die nette Frau nicht in dieser Kammer hier schlafen ließe, dann hättest Du im Regen schlafen müssen. Wie hast Du Dir das vorgestellt - dass Du immer Menschen findest, die Dir auf eigene Kosten gnädig gesonnen sind?
Wie willst Du weitermachen, wenn das Wetter so bleibt? Aus eigener Kraft kriegst Du das nicht hin!
Du wirst zu dämlich sein, das Zelt trocken aufzubauen.
Ich liege also auf dem blauen Velours-Luftbett und komme in den Genuss einer offenen Freundlichkeit. Der Umstand, dass mir diese Freundlichkeit einfach so zufliegt, dass jemand nett zu mir war und ich das einfach so angenommen habe, ohne etwas zurückgeben zu können, frisst mich von innen auf. In dieser Kammer fühle ich mich verloren, die Stille hüllt mich ein, draußen nur das gleichmäßige Schnurren des riesigen Windrades, an dem der stürmische Wind zerrt. Ich liege da und weine und finde mich unerträglich, so weinend. Zumal ich den Finger nicht auf das legen kann, was mich zum Weinen bringt. Verloren wie ein Kind fühle ich mich, kalt trotz der Wärme, die man mir entgegengebracht hat.
Es rettete mich, was bislang noch immer funktioniert hat: Das kleine Notizbuch und der Bleistift, die ich mir eingesteckt habe, verankern mich wieder. Zu versuchen, diesen Erlebnissen Ausdruck zu verleihen, macht die Sache plötzlich greifbar. Im Schlafsack sitze ich, mit krummem Nacken, das Luftbett knirscht auf dem Fliesenboden, und meine Schrift füllt die Seiten. Jetzt nicht aufgeben, sondern die Wärme und Trockenheit schätzen. Schlafen und schauen, was der Himmel mir morgen für ein Gesicht zeigt. Ruhe, Ruhe haben, innen in mir.
Es gelingt mir irgendwann, und der Morgen fühlt sich in der Tat anders an. Es sind keine Sinnsprüche, die mich durch diese Zeit bringen, keine Platitüden oder kluger Rat aus Büchern. Es hilft nur, anzusehen, was ist, anstatt vorwegnehmend zu fürchten, was sein wird.
Der folgende Tag wird nicht besser im Bezug auf Nässe und Regen, aber die Seele beginnt, sich zu akklimatisieren und zu begreifen, ich bin nicht das Nichts, das zu sein ich fürchte. Ich bin ein Mensch, nicht mehr, nicht weniger.
Als solcher bin ich zu meiner eigenen Überraschung zu vielem fähig. Die Art, wie sich mein Körper innerhalb dieser kurzen Zeit an die Umstände anpasst, denen ich ihn aussetze, verblüfft mich. Er gewinnt eine gewisse Zähigkeit und Drahtigkeit, hier und da ein paar blaue Flecke, mal ein Ziepen im Rücken, wenn ich den Rucksack falsch greife. Ich beginne, diesen Körper zu bewundern auf eine Weise, wie ich es niemals könnte, hätte ich ihn aufwändig in einem Studio in Form gebracht. Ich sehe, ich kann mit ihm Dinge erreichen, die mich erstaunen.
Möglicherweise beginnt alles damit, dass man einen Schritt vor den anderen setzt. Der vor mir liegende Weg sah so oft so endlos lang aus. Trotzdem erfahre ich, dass auch dieser lange Weg aus einzelnen Schritten besteht, die gegangen werden können. Voraussetzung dafür ist, dass man sie geht.
Mein eigenes Wirken, die eigene Kraft zu erleben ist kontraproduktiv für die Depression. Als Kilometerfresser mit siebzehn Kilo Gepäck auf dem Rücken fällt es einem schwer, die eigenen Fähigkeiten zu negieren. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieser äußerst kurzen Reise, auch wenn ich diese Reise niemals hätte machen können, um diese Erkenntnis zu erlangen. Sie kommt nur von allein.
Das Gefühl des Versagens hat sich aufgelöst. Alles, was ich nach meiner ersten Nacht in der Kammer auf dem Campingplatz tat, ereignete sich unter anderen Vorzeichen. Das heißt nicht, dass keine Verzweiflung, keine Anstrengung, keine Angst mehr dagewesen wären. Dass keine Tränen mehr geflossen wären. Es heißt auch nicht, dass ich das Patentrezept aufgetan hätte, das meinem Kopf und meiner Seele Freiheit verspräche.
Es ging nur einfach weiter.
Nach Wochen und Wochen der Plackerei, nach Überstunden, Stress und Großprojekten vierzehn Tage Urlaub zu haben, sollte mich ja eigentlich in einen Zustand des Glücks versetzen. Endlich habe ich die Freiheit, zu tun, was ich will, Freiheit von der Stempeluhr, Freiheit von Alltagssorgen, die Freiheit, über meine eigene Zeit zu bestimmen und hinzugehen, wo ich will, wann ich es will. Ganz so einfach ist es aber nicht.
Auch wenn ich verreise, reist die Depression mit mir. Das Harte, Alte, Dunkle greift nach mir, und es kommt zuverlässig. Es begreift nicht, dass vierzehn Tage lang alles anders sein soll als sonst.
Unterwegs auf meinen eigenen zwei Beinen besteht aber der Unterschied darin, dass ich mich nicht verkriechen kann und dass bestimmte Notwendigkeiten mich dazu zwingen, neue Erfahrungen zu machen. Möglich, dass genau das der Grund war, allein und zu Fuß zu gehen. Großartige Erkenntnisse kommen einem nicht, auch nicht auf so einer Reise. Es ist nicht so, dass man beim letzten Schritt noch depressiv war und es beim nächsten nicht mehr ist, und dass Erleuchtung vom Himmel fiele.
In meinem Leben war ich schon oft einfach mit Aushalten beschäftigt. Weiteratmen. Natürlich auch mit der in meinem Kopf rasenden Analyse der Dinge. Wieso geht es mir jetzt schlecht? Ich habe doch alles.... Genau. Immer braucht alles einen Grund.
Es war am Abend meines ersten Tages in Friesland, als es mir am schlimmsten ging. Meine Depression hält sich normalerweise hauptsächlich in den eigenen vier Wänden auf - ich weiß nicht, wievielen anderen Menschen es noch so gehen mag. Sie ist eine Krankheit des Verharrens. Verharren ist aber nicht möglich, wenn man unterwegs ist. Meine Gefühle kondensierten an der Oberfläche dessen, was mir begegnete. Das Schöne und das Schreckliche sind dabei so dicht beieinander, dass es beinahe unglaubwürdig wirkt.
Als ich heulend an der Nordseeküste entlanglief, waren das Tränen von Glück und Lebendigkeit. Ich war einfach da, atmete die salzige Luft, sah das Glitzern auf dem Wasser und machte mir noch keine Sorgen um später.
Später, auf einem Luftbett in einer Kammer liegend, die die Betreiberin meines ersten Campingplatzes für mich hergerichtet hatte, hätte ich mich eigentlich heimelig und wohl fühlen können. Um nicht missverstanden zu werden - ich war zutiefst dankbar. Dafür, einem Menschen begegnet zu sein, der mir ein festes Dach über dem Kopf anbot, während es draußen stürmte und regnete, und der das ohne viel Aufhebens und mit großer Freundlichkeit tat. Ich hätte so bleiben können - dankbar, warm, behaglich. Aber das ging nicht.
Am schwersten in meinem Rucksack wogen nicht das Zelt und nicht das Trinkwasser. Am schwersten wog, was mich immer begleitet: die Dunkelheit. Diese Dunkelheit spricht.
Wenn Dich jetzt dieser junge Mann nicht im Auto mitgenommen hätte, dann hättest Du das heute gar nicht schaffen können.
Wenn Dich die nette Frau nicht in dieser Kammer hier schlafen ließe, dann hättest Du im Regen schlafen müssen. Wie hast Du Dir das vorgestellt - dass Du immer Menschen findest, die Dir auf eigene Kosten gnädig gesonnen sind?
Wie willst Du weitermachen, wenn das Wetter so bleibt? Aus eigener Kraft kriegst Du das nicht hin!
Du wirst zu dämlich sein, das Zelt trocken aufzubauen.
Ich liege also auf dem blauen Velours-Luftbett und komme in den Genuss einer offenen Freundlichkeit. Der Umstand, dass mir diese Freundlichkeit einfach so zufliegt, dass jemand nett zu mir war und ich das einfach so angenommen habe, ohne etwas zurückgeben zu können, frisst mich von innen auf. In dieser Kammer fühle ich mich verloren, die Stille hüllt mich ein, draußen nur das gleichmäßige Schnurren des riesigen Windrades, an dem der stürmische Wind zerrt. Ich liege da und weine und finde mich unerträglich, so weinend. Zumal ich den Finger nicht auf das legen kann, was mich zum Weinen bringt. Verloren wie ein Kind fühle ich mich, kalt trotz der Wärme, die man mir entgegengebracht hat.
Es rettete mich, was bislang noch immer funktioniert hat: Das kleine Notizbuch und der Bleistift, die ich mir eingesteckt habe, verankern mich wieder. Zu versuchen, diesen Erlebnissen Ausdruck zu verleihen, macht die Sache plötzlich greifbar. Im Schlafsack sitze ich, mit krummem Nacken, das Luftbett knirscht auf dem Fliesenboden, und meine Schrift füllt die Seiten. Jetzt nicht aufgeben, sondern die Wärme und Trockenheit schätzen. Schlafen und schauen, was der Himmel mir morgen für ein Gesicht zeigt. Ruhe, Ruhe haben, innen in mir.
Es gelingt mir irgendwann, und der Morgen fühlt sich in der Tat anders an. Es sind keine Sinnsprüche, die mich durch diese Zeit bringen, keine Platitüden oder kluger Rat aus Büchern. Es hilft nur, anzusehen, was ist, anstatt vorwegnehmend zu fürchten, was sein wird.
Der folgende Tag wird nicht besser im Bezug auf Nässe und Regen, aber die Seele beginnt, sich zu akklimatisieren und zu begreifen, ich bin nicht das Nichts, das zu sein ich fürchte. Ich bin ein Mensch, nicht mehr, nicht weniger.
Als solcher bin ich zu meiner eigenen Überraschung zu vielem fähig. Die Art, wie sich mein Körper innerhalb dieser kurzen Zeit an die Umstände anpasst, denen ich ihn aussetze, verblüfft mich. Er gewinnt eine gewisse Zähigkeit und Drahtigkeit, hier und da ein paar blaue Flecke, mal ein Ziepen im Rücken, wenn ich den Rucksack falsch greife. Ich beginne, diesen Körper zu bewundern auf eine Weise, wie ich es niemals könnte, hätte ich ihn aufwändig in einem Studio in Form gebracht. Ich sehe, ich kann mit ihm Dinge erreichen, die mich erstaunen.
Möglicherweise beginnt alles damit, dass man einen Schritt vor den anderen setzt. Der vor mir liegende Weg sah so oft so endlos lang aus. Trotzdem erfahre ich, dass auch dieser lange Weg aus einzelnen Schritten besteht, die gegangen werden können. Voraussetzung dafür ist, dass man sie geht.
Mein eigenes Wirken, die eigene Kraft zu erleben ist kontraproduktiv für die Depression. Als Kilometerfresser mit siebzehn Kilo Gepäck auf dem Rücken fällt es einem schwer, die eigenen Fähigkeiten zu negieren. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieser äußerst kurzen Reise, auch wenn ich diese Reise niemals hätte machen können, um diese Erkenntnis zu erlangen. Sie kommt nur von allein.
Das Gefühl des Versagens hat sich aufgelöst. Alles, was ich nach meiner ersten Nacht in der Kammer auf dem Campingplatz tat, ereignete sich unter anderen Vorzeichen. Das heißt nicht, dass keine Verzweiflung, keine Anstrengung, keine Angst mehr dagewesen wären. Dass keine Tränen mehr geflossen wären. Es heißt auch nicht, dass ich das Patentrezept aufgetan hätte, das meinem Kopf und meiner Seele Freiheit verspräche.
Es ging nur einfach weiter.
Dienstag, 7. Juli 2015
Psychotherapie, zweite Runde
Am 7. Jul 2015 im Topic 'Tiefseetauchen'
Während vor mir dieses leere Textfeld wartet, gefüllt zu werden, merke ich, was für Hemmungen ich doch habe, dies hier zu schreiben. Wenn ich genauer darüber nachdenke, hängen diese Hemmungen unmittelbar mit dem zusammen, was ich mir als Klischees über Psychotherapie in den Köpfen anderer vorstelle. Vorurteile. War klar, die hat ja auch einen an der Waffel!
Ja, ich hab' sie nötig. Das möchte ich trotz allem inzwischen so deutlich schreiben. Weil es eben keine Schande ist und keine Schwäche, sich an jemanden zu wenden, der der Seele helfen kann. Ich bin es mir einfach schuldig - das wurde mir vor ein paar Wochen klar. Talsohle erreicht, Leidensdruck groß genug. Und bereits ab dem Moment, in dem mich mein Therapeut zurückrief, um einen Termin auszumachen, merkte ich, dass das gut tut. Zu glauben, ich müsse alles allein bewältigen, ist Teil des Problems. Das erschwert die Sache, wenn es nicht sogar unmöglich macht, nach Hilfe zu greifen.
Heute, im Sessel ihm zum ersten Mal seit Jahren wieder gegenüber sitzend, habe ich gemerkt, dass ich mich wider Erwarten auch verändert habe. In mir ist mehr Leben. Das ist mir so kostbar, dass ich es nicht an die allesfressenden Ängste und harten Ansprüche in mir verschwenden will.
Ab und an braucht man jemanden, an dessen Seite man wieder man selbst werden kann.
Meine Musik des Tages:
My Vitriol - Always Your Way
Ja, ich hab' sie nötig. Das möchte ich trotz allem inzwischen so deutlich schreiben. Weil es eben keine Schande ist und keine Schwäche, sich an jemanden zu wenden, der der Seele helfen kann. Ich bin es mir einfach schuldig - das wurde mir vor ein paar Wochen klar. Talsohle erreicht, Leidensdruck groß genug. Und bereits ab dem Moment, in dem mich mein Therapeut zurückrief, um einen Termin auszumachen, merkte ich, dass das gut tut. Zu glauben, ich müsse alles allein bewältigen, ist Teil des Problems. Das erschwert die Sache, wenn es nicht sogar unmöglich macht, nach Hilfe zu greifen.
Heute, im Sessel ihm zum ersten Mal seit Jahren wieder gegenüber sitzend, habe ich gemerkt, dass ich mich wider Erwarten auch verändert habe. In mir ist mehr Leben. Das ist mir so kostbar, dass ich es nicht an die allesfressenden Ängste und harten Ansprüche in mir verschwenden will.
Ab und an braucht man jemanden, an dessen Seite man wieder man selbst werden kann.
Meine Musik des Tages:
My Vitriol - Always Your Way
Samstag, 23. Mai 2015
Widrigkeiten
Am 23. Mai 2015 im Topic 'Tiefseetauchen'
Wenig Schreibelaune gerade. Wieder mal haben die Wochen 50 Stunden statt 40, müssen Aufträge ganz dringend bis gestern erledigt werden, und am Donnerstag habe ich 15 Stunden am Stück durchgearbeitet. Keine Zeit zum Schlafen, keine Zeit, ordentlich zu essen, keine Ruhe, um mich richtig zu erholen. Daneben bleibt alles andere liegen. Das vor mir liegende lange Wochenende mildert die Spannung, von der ich einfach hoffe, dass sie sich auch mal über längere Zeiträume etwas gibt.
Dabei weiß ich, dass es auch an mir liegt. Der Druck, ständig 300 Prozent geben zu müssen, ist irgendwie in mein Leben eingebaut. Die Häme und Strenge, mit denen das Urteil über mich fällt, sind so intensiv, dass es unmöglich ist, es einfach drauf ankommen zu lassen, auch mal Fehler zu machen. Es gibt kein "Habe ich nicht geschafft...", "Ging nicht!", "Morgen ist auch noch ein Tag!" Je mehr ich mich abzappele, um so höher steigt auch der Maßstab, ins Unermessliche. Und was mich am meisten fertig macht ist, dass auch ausgleichende Erfahrungen es überhaupt nicht erst schaffen, sich mir nachhaltig einzuprägen. Beinahe jeden Tag erlebe ich, dass Versäumnisse mich nicht den Kopf kosten, dass jeder Fehler macht, dass alles ganz menschlich zugeht, und trotzdem...
Kein Wunder, dass das mir die Energie raubt. Der neue Arzt empfahl Sport, der mich auspowert. Ich selbst wünsche mir die Kraft, all die Dinge und Ideen ins Leben zu rufen, die mir durch den Kopf geistern. Aber harte Maßstäbe, ganz gleich, woher sie kommen, sind tödlich für Kreativität. Immer wird Wollen gleich zu Müssen. Ohne Leistung läuft in meinem Leben nichts. Dinge um ihrer selbst willen zu tun, ist kaum möglich.
Meine Überwachungsinstanz verzeiht nichts, gönnt nichts, lobt nichts und lässt vor allem keinen Frieden. Stress von außen ist eine Sache, diese Folter eine ganz andere. Ich ahne, das hört nie auf. Nicht, wenn sich nicht in meinem Leben noch einmal etwas ändert. Wie ich das hinbekomme, muss ich erst noch herausfinden. Vor allem möchte ich nicht das auch noch gut machen müssen.
Dabei weiß ich, dass es auch an mir liegt. Der Druck, ständig 300 Prozent geben zu müssen, ist irgendwie in mein Leben eingebaut. Die Häme und Strenge, mit denen das Urteil über mich fällt, sind so intensiv, dass es unmöglich ist, es einfach drauf ankommen zu lassen, auch mal Fehler zu machen. Es gibt kein "Habe ich nicht geschafft...", "Ging nicht!", "Morgen ist auch noch ein Tag!" Je mehr ich mich abzappele, um so höher steigt auch der Maßstab, ins Unermessliche. Und was mich am meisten fertig macht ist, dass auch ausgleichende Erfahrungen es überhaupt nicht erst schaffen, sich mir nachhaltig einzuprägen. Beinahe jeden Tag erlebe ich, dass Versäumnisse mich nicht den Kopf kosten, dass jeder Fehler macht, dass alles ganz menschlich zugeht, und trotzdem...
Kein Wunder, dass das mir die Energie raubt. Der neue Arzt empfahl Sport, der mich auspowert. Ich selbst wünsche mir die Kraft, all die Dinge und Ideen ins Leben zu rufen, die mir durch den Kopf geistern. Aber harte Maßstäbe, ganz gleich, woher sie kommen, sind tödlich für Kreativität. Immer wird Wollen gleich zu Müssen. Ohne Leistung läuft in meinem Leben nichts. Dinge um ihrer selbst willen zu tun, ist kaum möglich.
Meine Überwachungsinstanz verzeiht nichts, gönnt nichts, lobt nichts und lässt vor allem keinen Frieden. Stress von außen ist eine Sache, diese Folter eine ganz andere. Ich ahne, das hört nie auf. Nicht, wenn sich nicht in meinem Leben noch einmal etwas ändert. Wie ich das hinbekomme, muss ich erst noch herausfinden. Vor allem möchte ich nicht das auch noch gut machen müssen.
Montag, 16. Februar 2015
Relativ krank
Am 16. Feb 2015 im Topic 'Tiefseetauchen'
Ich liege unter der Wolldecke auf dem Sofa, auf dem Schoß das Laptop, mir ist kalt, ich bin müde. Warte aber noch auf den Anruf eines Kollegen, mit dem ich klären möchte, was in meiner Abwesenheit sonst auf meinem Schreibtisch liegenbliebe.
Ich bin krank. Das Stimmchen im meinem Kopf sagt: "Relativ krank!" Denn so schlimm können Glieder- und Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Husten ja nicht sein, dass ich deshalb zuhause bleiben dürfte. Mit mir sitzt also das schlechte Gewissen auf dem Sofa und motzt beständig.
Angesteckt habe ich mich bei den Kolleginnen. Die eine blieb deshalb bereits am Freitag zuhause, was bei mir zu einer leichten Panik angesichts der anstehenden Aufgaben führte, die mich überrollten wie ein Tsunami. Denn die andere Kollegin, die noch im Thema ist, hatte und hat noch Karnevalsurlaub. Helau!
Während die ganze Woche bis zu ihrem Urlaubsantritt kaum etwas zu tun war, quollen ausgerechnet am Freitagmorgen die Aufträge stapelweise herein, fast alle mit "ambestengestern"-Vermerk. Die Azubine war überfordert, machte aber angesichts der Umstände das beste daraus.
Heute konnte ich dann allerdings auch nicht mehr. Zuerst war ich versucht, die kranke Kollegin anzurufen und nachzufragen, ob sie denn ihrerseits heute wieder im Betrieb auftauchen würde. Falls nicht, so mein Plan (nachts um 3:10 Uhr), würde ich mich halt aufraffen. Dann wurde mir klar, dass ihre Krankheit auch nicht schwerer wiegt als meine, da wir ja schließlich beide dasselbe haben und beide in etwa gleich arbeitsfähig sind.
Die Rückstufung meiner eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten hinter die anderer hat nichts mit irgendeiner kruden Art Altruismus zu tun. Sie kommt aus der Angst vor Vorwürfen, Abmahnungen, Rechtfertigungszwang, Nichternstgenommenwerden. Und ist deswegen doppelt blöd. Ich habe keine Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt oder ein Terrorist mich ins Jenseits bombt. Aber ich habe Angst davor, dass mir jemand ein falsch gesetztes Satzzeichen ankreidet, mir vorwirft, ich stelle mich nur an oder ich würde es wahlweise an Sorgfalt, Pflichtgefühl, Effizienz oder Schnelligkeit vermissen lassen.
Das ist gaga. Ich bin nicht relativ krank, es geht mir offen gestanden ziemlich lausig.
Aber Blogbeiträge schreiben kannste noch, wie?
Na dann. Bis zur Besserung dauert's wohl noch.
Ich bin krank. Das Stimmchen im meinem Kopf sagt: "Relativ krank!" Denn so schlimm können Glieder- und Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Husten ja nicht sein, dass ich deshalb zuhause bleiben dürfte. Mit mir sitzt also das schlechte Gewissen auf dem Sofa und motzt beständig.
Angesteckt habe ich mich bei den Kolleginnen. Die eine blieb deshalb bereits am Freitag zuhause, was bei mir zu einer leichten Panik angesichts der anstehenden Aufgaben führte, die mich überrollten wie ein Tsunami. Denn die andere Kollegin, die noch im Thema ist, hatte und hat noch Karnevalsurlaub. Helau!
Während die ganze Woche bis zu ihrem Urlaubsantritt kaum etwas zu tun war, quollen ausgerechnet am Freitagmorgen die Aufträge stapelweise herein, fast alle mit "ambestengestern"-Vermerk. Die Azubine war überfordert, machte aber angesichts der Umstände das beste daraus.
Heute konnte ich dann allerdings auch nicht mehr. Zuerst war ich versucht, die kranke Kollegin anzurufen und nachzufragen, ob sie denn ihrerseits heute wieder im Betrieb auftauchen würde. Falls nicht, so mein Plan (nachts um 3:10 Uhr), würde ich mich halt aufraffen. Dann wurde mir klar, dass ihre Krankheit auch nicht schwerer wiegt als meine, da wir ja schließlich beide dasselbe haben und beide in etwa gleich arbeitsfähig sind.
Die Rückstufung meiner eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten hinter die anderer hat nichts mit irgendeiner kruden Art Altruismus zu tun. Sie kommt aus der Angst vor Vorwürfen, Abmahnungen, Rechtfertigungszwang, Nichternstgenommenwerden. Und ist deswegen doppelt blöd. Ich habe keine Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt oder ein Terrorist mich ins Jenseits bombt. Aber ich habe Angst davor, dass mir jemand ein falsch gesetztes Satzzeichen ankreidet, mir vorwirft, ich stelle mich nur an oder ich würde es wahlweise an Sorgfalt, Pflichtgefühl, Effizienz oder Schnelligkeit vermissen lassen.
Das ist gaga. Ich bin nicht relativ krank, es geht mir offen gestanden ziemlich lausig.
Aber Blogbeiträge schreiben kannste noch, wie?
Na dann. Bis zur Besserung dauert's wohl noch.
... früher
